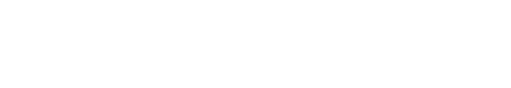Medienkonsum bei Schülern
Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen
Liebe Eltern,
im Folgenden wollen wir uns mit Fragen rund um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Das Thema ist ein Dauerbrenner.
Bei uns im Lernwerk steht ein Aspekt ganz besonders im Mittelpunkt: Welche Auswirkungen haben Smartphones mit Instagram, TikTok & Co, Online-Computerspiele und Streamingdienste wie Netflix eigentlich auf das Leben und den Schulalltag unserer Kinder? In meiner täglichen Arbeit erlebe ich, wie die elektronischen Medien - und hier besonders Social Media - einen immer größeren Teil der Freizeit unserer Schüler in Beschlag nehmen, wie dadurch die Schulleistungen schlechter werden und so eine Spirale aus Schulversagen und weiterem Rückzug vor den Bildschirm ihren Lauf nimmt. Es ist ein schleichender Prozess, der aber, gerade weil er langsam verläuft, nur schwer rückgängig zu machen scheint.
Auf der Suche nach einem gesunden Umgang mit Medien haben wir Erkenntnisse aus Psychologie und Hirnforschung und vor allem unsere langjährige Erfahrung herangezogen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, was genau es ist, das junge Menschen in den virtuellen Welten eigentlich suchen – und was sie dort oft über mehrere Stunden am Tag fesselt. Denn erst, wenn wir als Eltern und Lehrer die Bedürfnisse verstehen, die hinter dem Verhalten unserer Kinder stehen, können wir ihnen dabei helfen, etwas zu ändern.
In unseren beliebten „Lernen lernen“-Kursen besprechen und üben wir mit den Schülerinnen und Schülern ein, wie sie den Verführungen aus Smartphone und PC widerstehen können. Im Rahmen des „Elterntrainings“ als Teil des Intensivkurses stehen unsere Pädagogen auch den Müttern und Väter bei diesem heißen Eisen zur Seite.
Die besten praktische Anregungen, wie sich Eltern zum Medienumgang ihrer Kinder verhalten können, haben wir für Sie in dem unterstehenden Ratgeber zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihre

Swantje Goldbach
Pädagogische Leiterin des Lernwerks
Einfach mal abschalten!
Im Bann des Bildschirms
Smartphone und Computer im Alltag unserer Kinder
Paul ist ein sechzehnjähriger Junge, wie wir ihn im Lernwerk immer häufiger kennen lernen: eher zurückhaltend, wenig kommunikativ, nicht direkt unsportlich, aber offensichtlich wenig geübt mit Ball und Fahrrad. Dafür ein Crack, was den Umgang mit dem Computer angeht. Seit er mit dreizehn einen eigenen PC bekam, sitzt er immer häufiger vor dem Bildschirm. Die Noten werden schlechter, die Eltern sind überrascht und besorgt: „Er war doch früher immer so ein guter Schüler.“
Victoria ist dreizehn Jahre alt. Der Unterricht geht momentan ziemlich an ihr vorbei. Sie hat nur ein Wort dafür: langweilig. Zuhause will sie von Schule erstmal nichts mehr wissen. Sie beantwortet ihre rund um die Uhr eintreffenden Kurznachrichten und gleichzeitig sucht sie in Ihren Film-Apps nach einem Programm, welches ihre Langeweile vertreibt. Ihre Lieblingsthemen rund um Liebe und Eifersucht sind zwar immer ähnlich, aber besser als Hausaufgaben sind sie allemal. Dementsprechend schleppend werden diese erledigt und ihre Mutter ist zunehmend verzweifelt. „Früher war sie so pflegeleicht, hat gelesen, ist geritten. Aber jetzt ist sie nur noch mit ihrem Handy beschäftigt. Wenn wir am Wochenende mal etwas gemeinsam unternehmen möchten, eine Wanderung zum Beispiel, will sie nicht mit.“
Warum nicht einfach abschalten?
Solche und ähnliche Kinder treffe ich täglich. Kinder, die oft mehrere Stunden am Tag vor dem Bildschirm verbringen und die auf die Frage, warum sie nicht einmal etwas anderes tun, konsterniert fragen: „Was soll ich denn sonst machen?“ Kinder, die trotz guter Intelligenz und schneller Auffassungsgabe bei den täglichen Aufgaben vergesslich und unkonzentriert wirken, denen es schwerfällt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und vor allem: entsprechend zu handeln. Denn die meisten erkennen durchaus, dass Computer, Fernseher und Smartphone ihre Zeit auffressen und sich negativ auf die Schulleistungen auswirken. Sie schaffen es aber einfach nicht, ihr Verhalten zu ändern.
Manche von ihnen bezeichnen sich selbst als süchtig, andere würden den Begriff der Sucht weit von sich weisen. Mir geht es weniger um Begrifflichkeiten, als um das Phänomen, das hinter diesem Verhalten steckt. Was ist es eigentlich, das Kinder an der Medienwelt so anziehend finden? Und wieso kommen sie so schwer davon los? Ein Blick auf die Suchtforschung kann bei der Klärung dieser Fragen womöglich weiterhelfen.
Schlechte Angewohnheit oder Sucht?
Die Anerkennung exzessiven Mediengebrauches als Sucht ist noch relativ jung, was damit zusammenhängt, dass Suchtforscher lange Zeit auf die Einnahme eines bestimmten Suchtstoffes fixiert waren (Alkohol, Drogen etc.). Erst die moderne Hirnforschung hat den Suchtbegriff auch auf nicht stoffliche Süchte erweitert. Grundlage dessen sind bahnbrechende Erkenntnisse über die enorme nutzungs- und erfahrungsabhängige Formbarkeit des menschlichen Gehirns.
Kurz gesagt: Es geht um die Macht der Gewohnheit. Der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther formuliert es in seinem Buch „Computersüchtig“ so:
„Im Gehirn von Menschen, die ihr Gehirn [...] immer wieder auf die gleiche Weise für das Erreichen eines bestimmten Ziels benutzen, entstehen aus den dabei aktivierten, anfänglich noch sehr filigranen Nervenverbindungen allmählich immer fester gebahnte Wege, Straßen und am Ende sogar breite Autobahnen, von denen man, wenn überhaupt, dann gar nicht so leicht wieder herunterkommt.“
Welche Rolle spielen die Gefühle im Zusammenhang mit einer Abhängigkeit?
Entscheidend für die Herausbildung einer Abhängigkeit ist aber nicht allein die regelmäßige Nutzung der immer gleichen Nervenverbindungen. Hinzukommen muss eine „Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn“ – also ein Gefühl. Dieses Gefühl muss sehr stark sein – so stark, dass ein negatives Ausgangsgefühl (Angst, Unsicherheit, innere Unruhe, Unzufriedenheit) plötzlich verschwindet, weil man etwas Bestimmtes tut. Man kommt zum Beispiel aus der Schule oder von der Arbeit nach Hause – verärgert, überlastet, unzufrieden – setzt sich vor den Fernseher oder den PC und nach einer Viertelstunde ist der ganze Frust vergessen. Die jeweilige Verhaltensweise ist so befriedigend, dass im emotionalen bzw. „Belohnungszentrum“ des Gehirns der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird, der Glücksgefühle auslöst. Und genau wegen dieser Glücksgefühle wird das Verhalten ständig wiederholt. Erst durch die Dopaminausschüttung kommt es also zu den beschriebenen Bahnungsprozessen im Gehirn.
Nun ist das Streben nach belohnenden Gefühlen nicht nur bei Jugendlichen verbreitet. Wir Erwachsene haben ebenfalls Bewältigungsstrategien entwickelt, um den negativen Gefühlen des Alltags zu entfliehen. Der eine braucht seinen täglichen Waldlauf, die andere ihre Tasse Kaffee am Nachmittag, die regelmäßige Shoppingtour am Wochenende oder eben auch den Fernseher. Was aber macht gerade den Medienkonsum und hier ausgerechnet Computerspiele und Smartphones so attraktiv?
Warum machen Computerspiele Spaß?
Der Pädagoge und Medienforscher Jürgen Fritz erläutert: „[Es sind] weniger die Gefühlsangebote auf der Inhaltsseite der Computerspiele, die zu diesen Gefühlen verhelfen können, als vielmehr funktionale Abläufe, in denen negative Gefühle wie Langeweile und Frust umgeformt werden in Gefühle des Erfolges und der Kompetenz. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es sogar möglich, dass sich FLOW-Erlebnisse einstellen.“
An dieser Stelle erinnern Sie sich vielleicht an unseren letzten Elternratgeber zum Thema „Motivation“, in dem wir das FLOW-Konzept aus der Glücksforschung ausführlich vorstellten. Demzufolge wird Glück vor allem im Rahmen von herausfordernden, zielgerichteten Tätigkeiten empfunden, die unser ganzes Leistungsvermögen in Anspruch nehmen. Auf den Inhalt der Tätigkeit kommt es dabei nur am Rande an.
Damit wird deutlich, warum z. B. Egoshooter bei einer bestimmten Gruppe von Jungen so beliebt sind. Nicht das Töten an sich versetzt die Jungs in einen Rausch, sondern das Glücksgefühl, das daraus erwächst, sich selbst ein Ziel zu setzen und es mit den eigenen Mitteln zu erreichen.
Das klingt makaber. Es bedeutet nicht, dass die Gewalt in Computerspielen harmlos wäre und keine Auswirkungen auf unsere Kinder hätte. Gerade weil diese Computerspiele solch perfekte FLOW-Erlebnisse ermöglichen, werden die Erfahrungen und Erlebnisse in den oftmals vielstündigen Computersitzungen besonders gut „gelernt“.
Natürlich wünschen wir uns nicht, dass der Zusammenhang zwischen Freude und Gewalt gelernt wird. Problematisch in diesen Zusammenhang ist auch, dass Jungen mit depressiver Verstimmung zu diesen und anderen Computerspielen neigen. Leere, Unglücklichsein und Isolation werden verstärkt.
Worauf sollten Lehrer und Eltern bei Computerspielen achten?
Uns als Lehrer und Eltern sollte klar sein, dass Computerspiele so aufgebaut sind, dass man möglichst viel Zeit mit ihnen verbringt und sie nicht aus dem Bewusstsein des Spielers rutschen. Durch Smartphones wird diese Tatsache noch verstärkt, da man nun immer und überall verfolgen kann, ob z. B. der "Clan" angegriffen wird. Jetzt ist es auch möglich, zu ungewöhlichen Zeiten, wenn die Gegner weniger aktiv sind (während der Schule, in der Nacht, etc.) in das Spielgeschehen einzugreifen.
Ein Grundproblem ist, dass viele Computerspiele sehr harmlos daherkommen und schon von jungen Kindern mit Erlaubnis der Eltern gespielt werden (z. B. Clash of Clans). Dieses Spiel entwickelt sich weiter, auch wenn man selbst nicht online ist. Dies ist unserer Auffassung nach ein Kriterium, das ein Spiel suchtgefährdend macht. Die Suchtexpertin Anne Wilkening zitierte in einem interessanten Vortrag folgende Studien, um zu erklären welche Art Spiele am stärksten abhängig machen:
"Das Genre Onlinerollenspiel erhöht signifikant das Risiko für eine Computerspielabhängigkeit. Besonders häufig betroffen sind Spieler von Onlinerollenspielen wie World of Warcraft, Metin und Guild Wars (Rehbein et al. (2010): Repräsentative Neuntklässlerbefragung (n = 15.168; [M] Alter = 15,3 Jahre; Deutschland).
Die Nutzung der Genres Onlinerollenspiel, Rollenspiel und Shooterspiel (z.B.Call of Duty, Counterstrike) erhöht das Risiko für eine Computerspielabhängigkeit. Elliott et al. (2012): Repräsentative Querschnittstudie (n = 3.380; USA)."
Wichtig für Eltern ist es, sich für das aktuelle Computerspiel ihres Kindes zu interessieren, auch einmal mitzuspielen und mit dem Kind im Dialog zu bleiben, um Risiken einschätzen zu können und mit kompetentem Rat zur Seite zu stehen. Nur Ablehnung und nicht hinschauen beseitigt leider den eventuell zu hohen Spielekonsum Ihres Kindes nicht.
Am Computer werden doch auch nützliche Fertigkeiten eingeübt – oder?
Weil die Erlebnisse am Bildschirm aufgrund ihrer belohnenden Wirkung besonders „eingängig“ sind, kommt das, was die Schule zu vermitteln versucht, natürlich viel zu kurz. Der Schulalltag ist eben – leider – zumeist deutlich weniger emotional aufwühlend und involvierend als ein Computerspiel oder der Chat mit den Freunden. Wenn das Gehirn die Wahl hat, ob es sich den Stoff eines Vormittags in der Schule oder die Erlebnisse eines Nachmittags bei „World of Warcraft“ und ein witziges Video, welches die beste Freundin geschickt hat einprägen soll, ist die Entscheidung klar. Dies führt dazu, dass die Realität zunehmend zur Nebensache wird, aus der man schnell wieder entfliehen möchte, weil sich die wirklich glücklich machenden Erlebnisse eben in der virtuellen Welt finden. Für die Schule bleibt schlicht kein Raum.
Kritiker halten dem entgegen, am Computer würden auch Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult, die durchaus nützlich seien. Tatsächlich bestätigen Wissenschaftler, dass die Intelligenz und Kreativität von Kindern noch nie so umfassend trainiert gewesen seien wie bei den „Computerkindern“ von heute. Insbesondere ihre Aufmerksamkeit werde durch regelmäßiges Videospielen messbar verbessert. Doch sollte man genau hinschauen und fragen, was diese höhere geistige Leistungsfähigkeit unseren Kindern eigentlich – jenseits der virtuellen Spielwelten – nutzt, ob sie ihnen also dabei hilft, in ihrem realen Leben besser zurecht zu kommen. Daran, so der Hirnforscher Manfred Spitzer, bestehen erhebliche Zweifel. So mag ein Videospiel, bei dem ich ständig von allen Seiten angegriffen werden kann, den Aufmerksamkeitsfokus erweitern. Ich kann nun alles Mögliche um mich herum schneller und effektiver wahrnehmen. Im Schulalltag muss ich mich allerdings in der Regel auf eine Sache konzentrieren – den Lehrer an der Tafel, den Text im Lehrbuch. Das gelingt immer mehr Kindern gerade nicht, wie die Häufigkeit des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS) zeigt, das ja genau dadurch charakterisiert ist, dass ein Kind sich nicht konzentrieren kann, sondern immer von anderen Dingen abgelenkt wird. Wir haben in unserem Lernen-lernen-Kurs gemeinsam mit unseren Schülern das Experiment gemacht, wie viele Kurznachrichten auf dem Smartphone ankommen, wenn man es einen Tag lang ausgeschaltet lässt. Der Gewinner des Kurses erhielt beim Wiederanschalten 572 WhatsApp-Nachrichten. Diese hätte er normalerweise über den Tag verteilt erhalten und wir alle waren überrascht und beunruhigt, wie viel Zeit diese Nachrichten den Schüler gekostet und wie sehr sie ihn abgelenkt hätten.
Noch einmal: Mit mangelnder Intelligenz hat dieses Abgelenktsein nichts zu tun! Wer genau hinschaut, erkennt, dass es diesen Kindern keineswegs schwer fällt komplexe Informationen zu verstehen und Probleme zu lösen. Lediglich die Strategien hierzu seien neu und anders, so der Familienpsychologe Wolfgang Bergmann in seinem Buch „Erziehen im Informationszeitalter“. Anstatt methodisch vorzugehen, wird ein Problem spontan angegangen, intuitiv und experimentell. Ist Papas Computer abgestürzt, so wird nicht etwa das Handbuch konsultiert, sondern herumprobiert, bei Freunden angerufen, im Internet nachgeschaut – und nach gewisser Zeit eine Lösung präsentiert, die funktioniert.
Was den Vater verblüfft, führt in der Schule allerdings zum Problem, denn hier wird gründliches, exaktes und strukturiertes Arbeiten erwartet. Würde der Sohn aufgefordert, seinen Lösungsweg in einem Schulaufsatz niederzuschreiben, wäre der Erfolg wahrscheinlich mäßig. Die strukturierte Wiedergabe von Gedanken oder Geschichten wird eben dort unmöglich, wo Gedanken nicht strukturiert fließen, sondern assoziativ umherspringen.
Wie unterscheiden sich Filmeschauen und Computerspielen in ihrer Wirkung?
Auch hier sind es belohnende Gefühle, die durch das Filmeschauen erzeugt werden, egal, ob sie auf dem Smartphone oder auf dem Fernseher gesehen werden. Die Belohnung liegt aber weniger in der Aktivität, in der Möglichkeit von Steuerung und Kontrolle, sondern im Nichtstun, in der Entspannung und Passivität. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen dies. Probanden berichten von einem entspannten und passiven Gemütszustand, der anhält, solange sie fernsehen, und abrupt abbricht, wenn das Gerät abgeschaltet wird. Weil die Entspannung rasch einsetzt, wird der Filmkonsument darauf konditioniert, Fernsehen mit Beruhigung und Spannungsabbau zu assoziieren.
Der beschriebene Entspannungszustand lässt sich übrigens im Gehirn anhand der Gehirnströme messen. Schon vor einigen Jahrzehnten stellten Wissenschaftler fest, dass das Gehirn beim Fernsehen in den sog. Alpha-Zustand versetzt wird, der ansonsten beim Übergang von Wachheit zum Schlaf oder beim Meditieren auftritt. Dieser Zustand ist vergleichbar mit einer Trance oder Hypnose, Bewusstseinsstadien also, in denen die Willenssteuerung weitgehend ausgesetzt ist. Nach meiner Erfahrung ist es genau das, was viele Schüler, gerade Mädchen, beim nachmittäglichen Schauen von Filmen und Serien suchen: den Schulalltag ausblenden und an nichts mehr denken müssen.
Das Bedürfnis nach Entspannung ist natürlich legitim. Doch ausgerechnet dieser Dämmerzustand und die damit verbundene Willenlosigkeit beim Fernsehen machen es so schwer, irgendwann auch wieder „aufzuwachen“ und sich den Herausforderungen der Realität, z.B. den Hausaufgaben, zu widmen. (Vertiefendes zu den gehirnphysiologischen Wirkungen des Fernsehens bei Rainer Patzlaff „Der gefrorene Blick“.)
Achtung, Löschung!
Wenn über den ganzen Tag konstant Informationen angeboten werden, weiß das Gehirn nicht mehr, welche Information relevant ist und ins Langzeitgedächtnis gelangen soll. Die starken Bilder der elektronischen Medien können den Lernstoff aus der Schule im Hirn überlagern, warnt Manfred Spitzer in seinem Buch "Vorsicht Bildschirm!".
Daher ist es wichtig für die Schüler zu wissen, dass Medienkonsum vor den Hausaufgaben dazu führt, dass man sich nicht zum Lernen aufraffen kann. Benutzt man seinen Computer oder sein Smartphone zum Fernsehen, Spielen und Chatten direkt nach dem Lernen oder in den Lernpausen, so kann der gerade eingeprägte Stoff gelöscht werden. Dies ist besonders relevant, wenn man sich in Prüfungsphasen und Klausurvorbereitungen befindet.
Smartphones - die größte Herausforderung
"Lara und Marie haben auch schon eins!", das hören sich Evas Eltern nun schon seit Wochen an. So ist klar, was sich Eva zu ihrem neunten Geburtstag an erster Stelle wünscht: ein Smartphone. Praktisch wäre es schon für sie, ein eigenes zu haben, denn ihre gesamte Hockeymannschaft tauscht sich über einen Gruppen-Chat über die Trainingszeiten aus. Evas Eltern werden langsam weich.
Der Besitz eines Smartphones birgt viele Herausforderungen, die man, wenn ein Kind klein ist, noch nicht so recht abschätzen kann. Vielen Eltern machen sich nicht genügend klar, dass ein Smartphone ein Computer und Fernseher im Kinderzimmer bedeutet. Ein Smartphone ist immer und überall verfügbar. Das bedeutet für das Lernen: Wenn die Hausaufgaben nicht spannend sein sollten, ist der Griff zum Telefon vorprogrammiert. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Man könnte nach den interessantesten neuesten Sneakers suchen, sich einen guten Song anhören, wütende Vögel durch die Gegend katapultieren, die neueste Folge der Lieblingsserie schauen und mal sehen, wie doof die anderen die Hausaufgaben finden.
Noch ist Eva klein, doch je älter sie wird, desto mehr Diskussionen wird es geben. "Leg bitte das Handy beim Essen weg!", "Mach das Gepiepe aus bei den Hausaufgaben, du kannst dich ja gar nicht konzentrieren!", "Schlaf jetzt, es ist spät. Mach das Ding aus!" ... Smartphones sind so konzipiert, dass der Konsument kaum noch darauf verzichten kann. Dies gilt auch für Erwachsene (Termine machen, Schritte zählen, Podcasts hören, ...). Wenn wir ehrlich sind, verbringen wir auch zu viel Zeit am Handy. Daher sollten Sie sich als Eltern vor der Anschaffung eines Smartphones für Ihr Kind über die Reizüberflutung und Off-Zeiten klar werden und mit dem Kind ausführlich darüber reden. Oft hilft es auch, etwas schriftlich zu fixieren. Allen Eltern, die sich an dieser Stelle sagen, "ich werde doch meinem Kind keinen unbegrenzten Internetzugang gewähren", sei gesagt, dass Kinder im Auffinden von Hot Spots einfach genial sind.
Außerdem raten wir Ihnen, sich ausführlich über folgende Punkte zu informieren und diese zusammen mit Ihrem Kind zu besprechen:
- Datenschutz im Internet
- Akzeptieren von App-Bedingungen
- Das Hochladen von eigenen Bildern und Bildern von Freunden
- Das Veröffentlichen von privaten Informationen
- Wie sicher ist eigentlich unsere Chatgruppe vor unerwünschten Besuchern?
- Welche Chatgruppe sollte man wählen in Bezug auf den Datenschutz?
- Das Kennelernen im Internet (Falschangaben) und die Gefahr, sich mit Fremden zu treffen
- Cypermobbing
- Was sind Cookies und wie löscht man sie?
- Das Herunterladen von illegalen Materialien (Filme, etc.)
- Das Öffnen von zugesendeten Videos, insbesondere von unbekannten Absendern, aber auch von Klassenkameraden
- Geld-Transaktionen im Internet
- Online-Spiele
- Gefahr, dass das Handy des Kindes "abgezogen" wird
Der Zusammenhang zwischen Erschöpfung und unserem Freizeitverhalten
In unseren Gesprächen treffen wir immer wieder auf Jugendliche, die davon erzählen, dass sie erschöpft und ausgebrannt seien. Von diesem neuen Phänomen berichtet auch Michael Schulte-Markwort in seinem Buch Burnout Kids. Er macht vor allen Dingen das Leistungsprinzip der Schule dafür verantwortlich. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass zudem falsches Freizeitverhalten eine Ursache dafür ist, dass Schüler sich nicht genug erholen können. Ihr Freizeitverhalten ist zu sehr Input-orientiert, als dass das Gehirn Erholung finden kann. Es geht also um eine Balance zwischen Input und Output eines Menschen. In unseren Lernen-lernen-Kursen gehen wir besonders tief darauf ein, wie eine solche Balance in der Freizeitgestaltung zu schaffen ist. Schüler können den Output vielfältig gestalten, z. B. durch Bewegung, Kreativität, persönliche Kommunikation, Kochen etc. Oft scheitern Aktivitäten jedoch an medialen Störungen („Was piept denn da?“), lohnen sich nicht mehr durch Zeitfresser („Bevor ich mein Zimmer aufräume, schau ich noch mal schnell auf Instagram nach, was es Neues gibt“) oder die vielfältigen Möglichkeiten, die man hätte, um seine Freizeit zu gestalten („Ich schau mal nach, was heute in Berlin so los ist.“).
Lotte, Ben, Ruben und Jette wollen am Nachmittag etwas unternehmen. Das haben sie in der Schule schon besprochen. Um 16 Uhr beginnen sie ihren Gruppen-Chat – es entspinnt sich ein witziges Gespräch und alle Möglichkeiten werden abgeklopft. Sollte man zum See gehen? Oder doch endlich mal wieder ins Kino? Was läuft da eigentlich? Ruben erhält ein cooles Video von Piet – dieses muss er sofort in der Gruppe teilen. Was läuft eigentlich zwischen Piet und Johanna? Sollte man jetzt einfach ins Café gehen? Letztes Mal waren da so doofe Leute … Mit einem Blick auf die Uhr bleiben die vier letztlich doch zu Hause und vertagen ihr Treffen. Alle Alternativen abzuwägen hat viel Zeit in Anspruch genommen. Es ist ein interessantes Phänomen, dass, obwohl wir durch Computer, Internet und Smartphone jede Menge Zeit sparen, die uns für Freizeitaktivitäten zur Verfügung steht, gleichzeitig „die Anzahl der Möglichkeiten, für die wir die eingesparte Zeit verwenden können, inflationär angestiegen ist. Allein die Vergleichsportale für tausende Produkte und Reisen, die unzähligen E-Mails und die sozialen Netzwerke sind Zeitfresser ungeahnten Ausmaßes. Genau diese Vielfalt führt zu Problemen des „Keine-Zeit-Habens“.“, so erklärt Markus Hornig im Buch Lebensenergie warum die stress- und erschöpfungsbedingten Krankheiten sprunghaft angestiegen sind.
Was wir Schülern raten können, ist auf eine einfache Formel gebracht: Unternehmt etwas zusammen. Ein langer Chat, Videos schauen oder Computerspielen bringen leider keinen Ausgleich für das lange Stillsitzen und Beanspruchen des Gehirns in der Schule. Fühlt man sich erschöpft, braucht man eine bessere Balance zwischen Input und Output.
Was suchen Kinder in den virtuellen Welten, das ihnen das wahre Leben nicht bietet?
Obwohl viele Eltern sich der vorher beschriebenen Probleme durchaus bewusst sind und obwohl viele Schüler merken, dass ihr Medienkonsum sie zunehmend erschöpft, fällt es schwer, das Handy auszustellen, die Serie zu unterbrechen oder das Computerspiel zu pausieren.
Forscher sind sich einig, dass das Medienverhalten unserer Kinder nicht nur dem Vergnügen dient, sondern vielfach als eine Art Flucht zu verstehen ist. Sie wollen der langweiligen Realität entfliehen (Schulnoten, Arbeitsblätter, Hausaufgaben, Klassenarbeitsvorbereitung etc.), weil das „wahre Leben“ ihnen ganz offensichtlich nicht das bietet, was sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigen. Nicht die Medien selbst und ihre Inhalte, sondern die unbefriedigten kindlichen Bedürfnisse sind also der Kern des Problems. Wir sollten uns diese Bedürfnisse deshalb noch einmal sehr genau anschauen.
Der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther beschreibt in seinem Buch Computersüchtig sehr eindrucksvoll, wie die kindlichen Bedürfnisse vor und nach der Geburt entstehen, wie sie im Laufe des Älterwerdens vernachlässigt werden und wie Kinder dadurch zunehmend das Vertrauen in sich selbst und in die Welt verlieren.
Laut Hüther bringt jedes Kind nicht nur ein ungeheures Maß an Neugier und Lernfähigkeit mit ins Leben, sondern auch ein Urvertrauen in die eigenen Möglichkeiten, ständig dazuzulernen und im umfassenden Sinne zu „wachsen“. Schließlich hat es bereits vor der Geburt und in den ersten Lebensjahren anhand der eigenen Entwicklung erlebt, dass es täglich über sich hinauswachsen kann. Je länger nun seine Erwartungshaltung bestätigt wird, das Kind also immer weiter Neues erleben und entdecken darf, desto fester wird diese Grunderfahrung im Gehirn „gebahnt“ und verankert. Aus der Erwartung wird ein inneres Bedürfnis, geradezu ein Hunger nach Neuem.
Was aber, wenn dieses Bedürfnis nicht gefüttert wird? Wenn das Kind irgendwann – häufig beim Eintritt in die Schule – merkt, dass seine Neugier nicht erwünscht ist oder in bestimmte Bahnen gelenkt werden soll? Wenn es feststellt, dass das, was bisher an ihm richtig war und was es an Fähigkeiten und Erfahrungen erworben hatte, sich im Zusammenleben mit anderen als unbrauchbar, unerwünscht oder gar falsch erweist? Wenn es sich, anstatt Ermutigung, Zuwendung und Anregungen zu erfahren, zunehmend unerfüllbaren Forderungen und Erwartungen gegenübersieht? Wenn es abgelehnt und gemaßregelt wird, weil es so ist, wie es ist?
Dann erlöschen nicht nur die Entdeckerfreude und die Lust am Lernen sondern auch das Bedürfnis, über sich hinauszuwachsen. Und damit schwindet letztlich auch die Überzeugung, dass alle Probleme lösbar sind und dass es überhaupt möglich ist, immer weiter über sich selbst hinauszuwachsen. Hüther: „Manche Kinder machen diese Erfahrung früher, manche später, aber allen geht dabei genau das verloren, was sie für ihr weiteres Leben dringlicher als alles andere brauchen: Vertrauen.“
Das eben Beschriebene spiegelt genau unsere Erfahrungen im Lernwerk wider. Da wir mit jedem Schüler, den wir in unseren Unterricht aufnehmen, sprechen, verfügen wir über einen ungeheuren Erfahrungsschatz, was die Beweggründe von Schülern sind, sich nicht zum schulischen Lernen aufraffen zu können. Ohnehin niemandem zu genügen ist ein ganz starkes Moment und dieses Gefühl zu überdecken der Motor für viele mit den Medien Stunden.
Was können wir für den besseren Medienumgang unserer Kinder tun?
Nein zu sagen ist schwer. Aus einem Gruppen-Chat auszusteigen, weil er blöd ist und nur Zeit frisst, dazu gehört einiges. Vielleicht verpasst man doch etwas. Schaut man sich Videos an, ist man ruhig gestellt und empfindet keine negativen Gefühle, außerdem sieht man da die tollsten Leute. Warum also nicht mal schnell bei YouTube vorbeischauen? Beim neuesten Computerspiel sind aktive und selbstgesteuerte Erfahrungen notwendig. Etwa der Erfolg, ein Pokémon zu fangen, kann ein echtes FLOW-Erlebnis auslösen. Medien bieten Kindern ganz klar Befriedigung von Grundbedürfnissen. Nach Gerald Hüther sind dies:
- erreichbare Ziele
- klare und verlässliche Strukturen und Regeln zur Zielerreichung
- die Möglichkeit zu selbstständigen Entscheidungen, für die man allein verantwortlich ist
- aufregende Entdeckungen
- Gefahren, Ängste und Bedrohungen, die man überwinden kann
- Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man erwerben kann
- Vorbilder, denen man nacheifern kann
- eigene Erfahrungen (Fehler), die klug machen
- Geschicklichkeit, die man weiterentwickeln kann
- Leistungen, auf die man stolz sein kann
All das müsste unseren Kindern und Jugendlichen also im wahren Leben geboten werden, um sie von den Bildschirmen wegzubekommen. Aber wo, fragt man sich unwillkürlich, ermöglichen wir ihnen heute noch solche Erlebnisse? Bieten wir Schülern Ziele an, die einen Sinn ergeben und für die es sich lohnt zu arbeiten – über die nächste Klassenarbeit oder das Abitur hinaus? Lassen wir zu, dass unser Kind Entscheidungen selbstständig trifft oder ist sein Tag bereits verplant, seine Zukunft vorgezeichnet – durch uns? Darf unser Kind Verantwortung übernehmen, muss es für seine Entscheidungen geradestehen? Oder nehmen wir ihm noch die kleinste Aufgabe ab und suchen für jedes Fehlverhalten eine Entschuldigung, die außerhalb seines Einflussbereiches liegt? Ermöglichen wir es unserem Kind überhaupt Fehler zu machen, aus denen es lernen könnte? Bietet die Schule Raum für echte Entdeckungen, erlebt man hier Unerwartetes und Überraschendes? Erlauben wir unseren Kindern in ihrer Freizeit Abenteuer zu erleben, gar Gefahren zu überwinden, um daran zu wachsen? Oder ist es nicht unser höchstes Ziel, sie genau davor zu bewahren? Hausaufgaben und Haushaltspflichten – sind das die Aufgaben, auf deren Bewältigung ein Kind stolz sein, an denen es über sich hinauswachsen kann?
Um die Ideen von Hüther umsetzen zu können, braucht es Kinder, die noch nicht zu lange mit Medien Umgang hatten. Deshalb plädieren wir im Lernwerk immer wieder dazu, nicht zu früh ein Smartphone anzuschaffen und keinesfalls Computer oder Fernseher im Kinderzimmer aufzustellen. Denn selbst ein schönes Abenteuer, das ein Kind mit seinen Eltern erleben kann, ist für viele, gerade wenn sie Medien gewohnt sind, nichts gegen die Bekämpfung eines Drachens oder den neuesten James-Bond-Film. So kommt es innerhalb von Familien zu großen Enttäuschungen, wenn man versucht, eine Wanderung in den Harz umzusetzen und dieser Vorschlag rundweg abgelehnt wird. Wenn ein Kind schon zu verstrickt in seinen Medienkonsum ist und ohne aggresiv zu werden nicht mehr verzichten kann und für keinerlei Spaß außerhalb der virtuellen Welt zu haben ist, sollte man sich externen Rat suchen. Sie als Eltern sollten, wenn letzteres auf Ihre Familie zutrifft, Ihrem Kind zeigen, dass es Ihnen genügt, auch wenn die Schulleistungen zu wünschen übrig lassen und dass sie gemeinsam nach Lösungen suchen.
Schwierige Aufgaben übertragen, Mut machen, Vertrauen schenken!
Damit wird eines klar: Wir können unseren Kindern nur helfen, indem wir ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, sich in der Wirklichkeit zurecht zu finden und das „reale“ Leben zu meistern. Wodurch kann das geschehen? Ganz bestimmt wird es nicht ausreichen, ihnen den Computer wegzunehmen oder die Nutzungszeiten einzuschränken. Durch Verbote, Ermahnungen oder auch nur gut gemeinte Appelle lässt sich Vertrauen nicht herbeireden – es muss wachsen.
Was Kinder ebenfalls nicht stärkt, ist der Drang vieler Eltern, sie vor den Widrigkeiten des Lebens „da draußen“ zu bewahren. Stark wird man nämlich nicht dadurch, dass man keine Probleme hat und keine Fehler macht. Im Gegenteil: Kinder brauchen echte Aufgaben, an denen sie wachsen können, sie brauchen konkrete Probleme, die sie meistern können und eigene Entscheidungen, die sie treffen können – im Zweifel auch falsch. Je glatter alles geht, desto weniger ist der Mensch gezwungen, sein Gehirn und seinen Körper anzustrengen. Und was nicht genutzt wird, verkümmert und wird schwach. Stark machen wir unsere Kinder einzig und allein dadurch, dass wir es ihnen ermöglichen so zu sein, wie sie ganz früher einmal sein durften – und wie sie in Wahrheit noch immer sind: unbefangen, neugierig, lernfreudig, ausdauernd, begeistert.
Während meiner Arbeit habe ich einige Beispiele erlebt, in denen es Kindern und Jugendlichen gelungen ist, diese Bedingungen im realen Leben wiederzufinden. Hier ist eines davon:
Ein Schüler brach in der elften Klasse des Gymnasiums die Schule ab, um eine Ausbildung in der Hotelfachschule zu beginnen. Schon in der Kindheit hatte er davon geträumt, in großen Hotels zu arbeiten, während die Eltern für ihn andere Pläne hatten – in jedem Fall zunächst das Abitur. Irgendwann begann der Kreislauf aus schlechten Noten, exzessiver Mediennutzung, noch schlechteren Noten – bis die Eltern nachgaben. Inzwischen unterstützen sie ihren Sohn auf seinem Weg. Ob er erfolgreich sein wird, steht noch nicht fest. Aber er hat die Entscheidung selbst getroffen und tut nun alles dafür zu beweisen, was er kann.
Entscheidend in diesem Beispiel ist die Erkenntnis, dass es einen Ausweg gibt aus der Sucht und dass dieser nicht immer in therapeutischen Maßnahmen zu finden ist. Auch ein vermeintlich unbedeutendes Erlebnis, eine Begegnung mit einem Menschen etwa, eine selbstständig erbrachte Leistung und die Anerkennung durch eine andere Person können der Auslöser für Veränderung sein. Der Einfluss von Eltern ist begrenzt, aber er ist vorhanden – und unendlich wichtig. Hirnforscher Hüther fasst es so zusammen: „Wer also Kinder [...] stark machen will, muss ihnen schwierige Aufgaben übertragen, ihnen Mut machen und ihnen Vertrauen schenken. So einfach ist das.“
Weitere Tipps für Eltern jüngerer Kinder
Nicht ruhigstellen
Klar, im Restaurant zu warten, ist für jüngere Kinder schwer. Darum ist es einfach, ihnen das Smartphone zu reichen. So schön still es nun auch im Restaurant wird, lernt ein Kind in diesem Moment nicht das Richtige. Dieses wäre: Es gibt Wartezeiten, die ich mit mir selbst überbrücken kann. Ich lausche den Gesprächen von Erwachsenen, auch wenn ich sie nicht verstehe. Ich schaue mich im Restaurant um und orientiere mich am Verhalten anderer.
Keine Gewohnheit im Medienumgang schaffen
„Immer Sandmännchen vorm Zubettgehen.“, „Wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, darfst du immer zur Belohnung Fifa spielen.“. Durch eine Ritualisierung von Medieneinsatz bahnt man im Gehirn sehr schnell den Wunsch, regelmäßig weiter und mehr zu konsumieren und sich dadurch zu belohnen.
Achtung, falsche Bilder!
Klar gibt es eine Altersempfehlung bei Filmen, doch viele Eltern denken sich, dass diese nicht gilt, wenn sie selbst dabei sind. Auch das Internet bietet zahllose Möglichkeiten, sich Videos anzuschauen, die keiner richtigen Alterszensur unterliegen. Ermutigen Sie Ihr Kind „Nein“ zu sagen, wenn es etwas nicht anschauen möchte („Traust du dich, dieses Video anzusehen?“). Falsche Bilder im Kopf können unheimliche Macht ausüben und schwer wieder abzulegende Ängste schüren.
Keine Hörspiele zum Einschlafen
Lisa ist abends quengelig und will nicht einschlafen. Ihre Eltern sind gegen Fernsehen. Hörspiele, besonders Hörbücher, finden sie dagegen viel besser. Allerdings hört Lisa am liebsten immer dieselbe CD. Sie hat sich angewöhnt, bei diesem Hörspiel einzuschlafen. Was die Eltern nicht wissen, ist, dass dies fatale Auswirkungen auf die Schulleistungen haben kann. Im Gehirn verankert sich nämlich die Erfahrung, dass Lisa immer dann abschalten kann, wenn jemand spricht. Das passiert ihr dann auch im Unterricht, wenn der Lehrer etwas erklärt. Deshalb raten wir grundsätzlich davon ab, Hörspiele und Radio im Einschlafprozess zu hören, um die Ohr-Aufmerksamkeit zu erhalten.